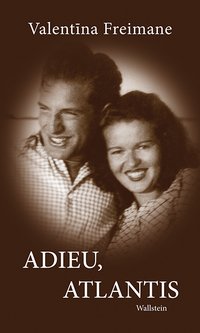Zum Buch:
Valentīna Freimane, Jahrgang 1922, überlebte als einzige aus ihrer Familie den Holocaust. Sie studierte in Riga Film- und Theaterwissenschaft, promovierte in Moskau in Kunstgeschichte und arbeitete dann an der lettischen Akademie der Wissenschaften. Seit 25 Jahren lebt sie in Berlin. In ihren Erinnerungen „Adieu, Atlantis“ erzählt sie von ihrer Kindheit und Jugend bis 1945. Ihre Erinnerungen teilt sie ein in „erstes“ und „zweites Leben“.
Valentīna wächst in einem kosmopolitischen, mondänen Elternhaus auf. Der Vater verdient als juristischer Berater großer Firmen, unter anderem der UFA, viel Geld und kann seiner Frau und seiner Tochter ein Leben ohne Entbehrungen bieten. Freimanes Mutter ist eine schöne, kultivierte Frau, die stets im Mittelpunkt der Salons und Gesellschaften steht. Die Familie lebt abwechselnd in Berlin und Riga und verbringt auch einige Jahre gemeinsam in Paris. Selbstverständlich spricht das Kind Deutsch, Russisch, Französisch und Lettisch. Den Sommer über verleben sie unbeschwerte Ferien in Jūrmala an der lettischen Ostseeküste. Anschaulich und liebevoll berichtet Freimane von der Pension Bergfeld, in der die Familie bei ihren Besuchen in Berlin stets lebte, und von der Begegnung mit Stummfilmstars wie Anny Ondra und Karel Lamač und den Theaterleuten, die ebenfalls dort wohnten.
Das Mädchen wächst auf unter Erwachsenen. Ihre Eltern behandeln sie als solche, lassen sie selbstverständlich teilhaben am kulturellen Leben, den Gesellschaften mit Künstlern und Intellektuellen. Sie darf lesen, was sie will, sieht Filme und ist keinerlei Zwang ausgesetzt. Nur ihre wechselnden Gouvernanten versuchen ab und an, ihre Freiheit durch erzieherische Maßnahmen einzuschränken, aber diese Versuche werden von den Eltern stets unterbunden. So unwahrscheinlich sonnig klingt diese Kindheit und die damalige Welt, dass Freimane sie selbst ihr verklärtes Atlantis nennt. Nur in den Erinnerungen, so Freimane bei HR2 Doppelkopf, könne dieses Atlantis wiederauferstehen.
Dass die Familie jüdisch ist, spielt zunächst kaum eine Rolle. In der Weihnachtszeit wird in Valentīnas Familie dreimal gefeiert: das jüdische Chanukkafest, dann das christliche und zuletzt das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest. In Lettland leben zu dieser Zeit Letten, Russen, Juden und Deutschbalten relativ friedlich nebeneinander und pflegen einen mehr oder weniger distanzierten Umgang. Freimane fasst ihre kindliche Wahrnehmung der besonderen Art des Zusammenlebens in Riga zu dieser Zeit bildlich: „Berlin war ein Schrank, Riga eine Kommode. In einem Schrank hängen alle Kleider nebeneinander und sind nach Bedarf und Laune kombinierbar. In einer Kommode liegen die Sachen getrennt in ihren Schubladen. Sie kommen zwar friedlich miteinander aus, aber die einmal festgelegte Unterteilung wird eingehalten.“ (S. 89).
Als 1935 klar geworden ist, dass die Nationalsozialisten an der Macht bleiben würden, zieht die Familie aus Berlin ganz nach Riga. Das „zweite Leben“ Valentīna Freimanes beginnt 1940 mit der ersten Besetzung Lettlands durch die Rote Armee. Unzählige Menschen wurden nach Sibirien deportiert. Bis dahin war das junge Mädchen mit Schule, Kultur und erster Liebe beschäftigt und kümmerte sich nicht um die Ereignisse in der Welt. Nach dem Angriff Hitlers auf die Sowjetunion 1941 aber wechselt die Besatzung, und die Situation der Juden in Riga wird lebensbedrohlich. Wer von ihnen noch nicht von der Sowjetunion deportiert worden ist, wird nun unter den Nationalsozialisten in ein Ghetto gesperrt und ermordet. Nur mit viel Glück und dank der Unterstützung hilfsbereiter Menschen überlebt Valentīna Freimane die Zeit zwischen 1941 und 1944 in über 50 verschiedenen Verstecken.
Der Leseeindruck wird stark geprägt von Freimanes leichtem und persönlichem Stil. Die Autorin hat ihre Erinnerungen nicht selbst geschrieben, sondern erzählt, so assoziativ und lebendig, wie sie ihr in den Sinn kamen.
Alena Heinritz, Mainz