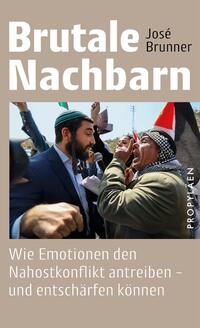Zum Buch:
Das Buch setzt ein mit dem 7. Oktober 2023, dem außerordentlich grausamen Terrorangriff der Hamas, und der darauf folgenden israelischen Invasion des Gazastreifens, die zum Vernichtungskrieg geworden ist – und mit der Frage, die José Brunner schon lange umtreibt: Wie ist es zu dieser unerbittlichen Brutalität des Nahostkonflikts gekommen?
Die Frage ist eine wissenschaftliche, die sich dem Autor aber auch persönlich stellt: Brunner ist 1976, wenige Tage vor dem sogenannten Jom-Kippur-Krieg, als Nachkomme von Holocaustüberlebenden aus der Schweiz nach Israel ausgewandert, hat hier seine Familie gegründet und viele Jahre an der Universität von Tel Aviv gelehrt. Dass persönliche Erfahrungen und die Beschreibung eigener Emotionen seine Analysen, historischen Einordnungen und politischen Einschätzungen begleiten, macht die besondere Stärke seines Buches aus.
Dem mittlerweile oft beklagten grundlegenden Befund, dass im Israel-Palästina-Konflikt die Fähigkeit oder der Wille zur Empathie für die jeweils andere Seite verlorengegangen sei, begegnet Brunner mit einer Darstellung, die dem Perspektivenwechsel verpflichtet ist. Das gilt für seine Beschreibung der tiefsitzenden kollektiven Traumata von Vertreibung, Zerstörung und Tod ebenso wie für die im letzten Kapitel gesuchten Auswege aus der entgrenzten Gewalt. Er zeigt Parallelen auf, betont aber auch das Machtgefälle der beiden Nationen und die dramatisch ungleichen Lebenschancen ihrer Mitglieder.
Für Brunner sind es „Emotionen, Gefühlswelten und psychologische Verfassungen“, die den komplexen und permanent eskalierenden Konflikt antreiben. Im Durchgang durch die wichtigsten historischen Stationen, in Portraits zentraler politischer Akteure, ihrer Verlautbarungen und Strategien legt er Muster eines „bösartigen Narzissmus“ frei: Er entsteht aus einem Gefühl der Schwäche, Ohnmacht und Scham, aus existentiellen Ängsten, die verdeckt werden durch wütende Degradierung und Dehumanisierung der andern sowie durch verhängnisvolle Illusionen der eigenen Omnipotenz. Brunner legt dar, wie die lange Geschichte der gegenseitigen Traumatisierung die Ausbildung einer einfachen Opfer-Täter-Weltanschauung begünstigt, die unter dem Einfluss des religiösen Extremismus – jüdischer Messianismus auf der einen, islamischer Fundamentalismus auf der anderen Seite – in einer Politik der absoluten Feindschaft kulminiert. In dieser Logik ist die eigene Existenz nur denkbar in der Zerstörung der andern.
Die Gewalt des 7. Oktobers und die israelische Kriegsführung haben in beiden Gesellschaften Erinnerungen an jene Traumata wachgerufen, die das Selbstbild ihrer Nationen definieren: an den Holocaust und an die Nakba. Diese Traumata begreift Brunner als „gewählte Traumata“ insofern, als sich ihre identitätsstiftende Funktion erst in politischen Prozessen und durch politische Weichenstellungen herausgebildet hat. Und weil sie die jeweilige nationale Identität nicht zwangsläufig bestimmen, kann sich das gesellschaftliche und politische Selbstverständnis auch verändern. Damit stellt Brunner selbstverständlich nicht die langfristige historische Erfahrung der (gegenseitigen) Traumatisierungen in Frage, aber er betont, dass diese Erfahrung nicht ausweglos sein muss. Wenn beide Seiten erkennen, dass sie sowohl Opfer als auch Täter sind, traumatisiert und traumatisierend, können sich Wege in eine Zukunft des Miteinanders öffnen.
Im letzten Teil fragt Brunner nach Möglichkeiten, den psychologisch-politischen Teufelskreis der Grausamkeit aufzubrechen. Eine Rückkehr zu den längst gescheiterten Friedensplänen bleibt illusorisch, wenn sich die gesellschaftlichen Grundhaltungen, Weltbilder und kollektiven Gefühlswelten nicht so verändern, dass die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts als eine gemeinsame Geschichte erfahrbar wird, in der sich beide Seiten als Opfer und als Täter akzeptieren, Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und vor allem: der Zukunft Vorrang vor der Vergangenheit geben.
Auch wenn die „Inseln der Vernunft“ klein und wenige sind, es gibt sie. José Brunner analysiert historische Situationen, die Alternativen aufzeigen, er erzählt von Kolleg:innen, einzelnen Akteur:innen, Initiativen, zivilgesellschaftlichen Netzwerken und NGOs, die friedensfördernde Dialoge anstoßen und aufrechterhalten. An die Leser:innen gerichtet, erinnert Brunner ganz zum Schluss an einen Satz Adornos, wonach Freiheit nicht darin besteht, zwischen Schwarz und Weiß zu wählen, sondern sich der vorgeschriebenen Wahl zu verweigern.
Sidonia Blättler, Frankfurt a. M.