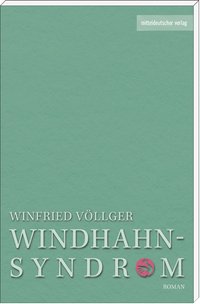Zum Buch:
Im Westen hat sich eine feste Meinung zur DDR-Literatur gebildet. Es gab die linientreue, die man hier nie gelesen hat und die zu Recht verschwunden ist. Und es gab die widerständige. Das waren die Bücher, in denen der DDR-Leser zwischen den Zeilen die Kritik am System finden konnte – eine Fähigkeit, die man als Westleser ebenfalls kultivierte. Letztere hat bis heute überdauert, ihre Autoren und Bücher bilden den Kanon der DDR-Literatur.
Manche sind durch dieses Raster gefallen, und so kommt es, dass ab und an bisher völlig unbekannte Werke auftauchen, bei denen man sich verblüfft die Augen reibt. Weil man nicht glauben kann, wie in diesem abgeschotteten, von der Stasi und von linientreuen Literaturbeamten verwalteten Buchmarkt ein Text erscheinen konnte, der unglaublich witzig, frech, despektierlich und beklemmend ist. Winfried Völlger, in der DDR als Kinderbuchautor bekannt, hat Anfang der achtziger Jahre so ein Buch geschrieben: „Das Windhahn-Syndrom“.
Ein junger Arzt der Psychiatrie schreibt einen Bericht über seine Patientin Claudia M.. Die hochbegabte Sprachwissenschaftlerin ist während eines Forschungsaufenthalts im Himalaya zusammengebrochen. Seit sie zurück in der DDR ist, wird sie, scheinbar ohne Motiv und vollständig unberechenbar, von Lachkrämpfen geschüttelt, die kaum zu stoppen sind und die sie an den Rand ihrer körperlichen und seelischen Kraft bringen. Dem medizinischen Personal fällt zu diesem Leiden nur ein, die Patientin mit Spritzen ruhig zu stellen. Von der ersten Seite an zeigt sich, dass es sich bei dem Bericht nicht um eine der üblichen Fallgeschichten handelt. Da der Arzt Claudia seit ihren Kindertagen kennt und ihre Lebensgeschichte mit der seinen verwoben ist und er zudem fest davon überzeugt ist, dass der Schlüssel zu ihrer Erkrankung in ihrer Biografie zu suchen ist, wächst sich der Bericht binnen kurzem zu einer Rückschau auf die Kindheit und Jugend in der DDR von 1948 bis in die siebziger Jahre aus.
Das Buch quillt über von Situationen, die abwechselnd komisch, absurd, grotesk und beklemmend sind. So wird Claudia, deren Eltern in den Westen ausgereist sind und die in einen aufmüpfigen, vielfach begabten Mitschüler verliebt ist, kurz vor dem Abitur von ihrem Klassenlehrer unter Einsatz von Alkohol und besorgter Zuwendung auf perfide Art dazu gebracht, ihren Freund zu verraten und in die Partei einzutreten. Ein junger, begeisterter Filmer, der seine Leidenschaft (und Ausrüstung) mit langweiligen Industriefilmen finanziert, filmt zufällig eine Katastrophe im Chemiewerk – was einen gigantischen Stasi-Einsatz nach sich zieht. Der Ich-Erzähler spielt der Wohnungsvergabestelle mit einer schwangeren Bekannten ein glückliches Paar vor, um eine eigene Wohnung zugewiesen zu bekommen.
Aber es sind nicht nur solch drastische Szenen, die den Leser die Luft anhalten lassen. Der ganze Tonfall des Romans ist bis in kleinste Nebenbemerkungen unglaublich frech und respektlos. Das ist nicht in jeder Szene gelungen, schmälert das Vergnügen der Lektüre aber nicht. Das Buch liest sich frischer als so mancher Post-Wende-Roman, und der Leser kommt nicht umhin, dieses Buch auf doppelte Weise zu lesen: als Unterhaltungsroman, der unter seiner ironischen Oberfläche ziemliche Untiefen verbirgt, und als Stück Zeigeschichte, das genauso irrwitzig ist wie der Plot des Romans. Das Nachwort des Autors zur Geschichte des Buches macht deutlich, wie dicht Romanhandlung und Realität beieinander lagen.
Ruth Roebke, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt