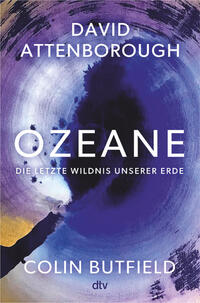Zur Autorin/Zum Autor:
Sir David Attenborough ist ein Rundfunksprecher und Naturforscher, dessen Fernsehkarriere sich bereits über sieben Jahrzehnte erstreckt. In dieser Zeit hat er sich mit mehreren bahnbrechenden TV-Serien als der weltweit führende Programmmacher für Naturgeschichte etabliert. Sein jüngstes Buch, ›Ein Leben auf unserem Planeten‹, das er mit Jonnie Hughes verfasst hat, war ein internationaler Bestseller.
Colin Butfield ist Mitbegründer und Regisseur von Open Planet Studios. Er hat an zahlreichen Dokumentar- und Kurzfilmen mitgearbeitet, u.a. an der BBC-Serie ›Earthshot‹, den Netflix-Filmen ›A Life on Our Planet‹ und ›Breaking Boundaries‹ sowie am National-Geographic-Dokumentarfilm ›Ocean‹, ebenfalls mit David Attenborough. Er ist Mitautor von ›Earthshot: How to Save Our Planet‹.
Jörn Pinnow arbeitet seit vielen Jahren als Übersetzer für Sachbücher und Belletristik.